Jeder Sechste hält „Anschreien“ in der Erziehung für angebracht
Berlin/Köln/Ulm •
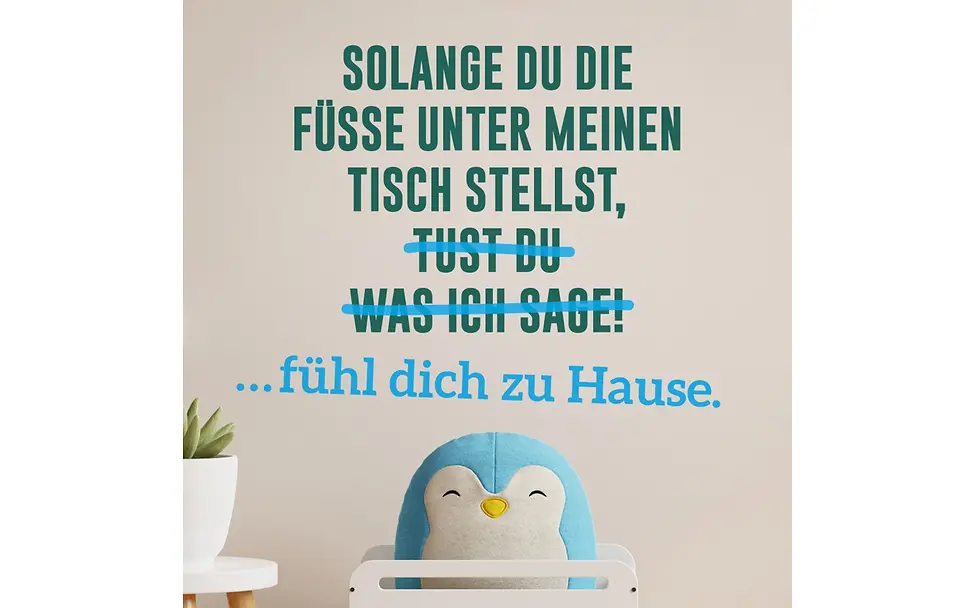
#NiemalsGewalt
© UNICEF DeutschlandAm 8. November 2000 trat in Deutschland das Recht jedes Kindes auf gewaltfreie Erziehung in Kraft. Ein Vierteljahrhundert später zeigt sich im Hinblick auf Einstellungen zu emotionalen Strafen ein widersprüchliches Bild: Zwar werden diese Strafen grundsätzlich mehrheitlich abgelehnt, in ihren einzelnen Ausprägungen stoßen sie jedoch nach wie vor auf Zustimmung. Dies zeigt eine aktuelle, repräsentative Befragung von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm und UNICEF Deutschland.
Laut der neuen Studie lehnen fast drei Viertel der Befragten emotionale Strafen in der Erziehung grundsätzlich ab. Einzelne Formen emotionaler Bestrafung stoßen jedoch auf Zustimmung: So halten 16,1 Prozent der Befragten das Anschreien für eine angemessene Erziehungsmaßnahme, 9,2 Prozent das Einsperren ins Zimmer und 8,6 Prozent das Nicht-mehr-Sprechen mit dem Kind. Jeweils rund fünf Prozent der Befragten halten emotionale Strafen wie Isolation von Familie oder Freunden, Auslassen einer Mahlzeit, Entzug von Aufmerksamkeit und Zuneigung sowie Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen für angemessen.
Auch unter den angewandten Formen emotionaler Gewalt wurde das Anschreien am häufigsten genannt: In einer kleineren Stichprobe von Befragten, die angaben, bereits Kinder erzogen zu haben, gab fast jede vierte Person an, diese Form selbst bereits ausgeübt zu haben. Häufig angewendet wurden zudem das Einsperren ins Zimmer (10,6 Prozent) und die Kommunikationsverweigerung gegenüber dem Kind (9,4 Prozent). Knapp zwei Drittel der Befragten mit Erziehungserfahrung gaben an, keine emotionalen Strafen angewandt zu haben.
Diskrepanz zwischen Einstellungen und Handeln – weitere Anstrengungen notwendig
Die Verankerung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung war ein gesellschaftlicher Wendepunkt, dessen Wirkung bis heute spürbar ist. Seitdem ist die Akzeptanz körperlicher Strafen deutlich gesunken und das Bewusstsein für die Rechte von Kindern hat spürbar zugenommen. Dennoch bleibt viel zu tun, um Kinder wirksam vor Gewalt in der Erziehung zu schützen. Aus Sicht von UNICEF Deutschland und dem Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut Prof. Dr. Jörg M. Fegert ist es daher entscheidend, das Recht auf gewaltfreie Erziehung in allen gesellschaftlichen Bereichen weiter zu stärken.
„Im Hinblick auf emotionale Gewalt bleibt die Lücke zwischen Wissen und Handeln groß. Zwar wissen viele Menschen, dass emotionale Strafen in der Erziehung nicht mehr angemessen sind – wenden sie jedoch trotzdem an. Auf der Handlungsebene besteht also noch erheblicher Bedarf an Aufklärung, Prävention und Unterstützung“, so Prof. Dr. Jörg M. Fegert. „Besonders wichtig ist es, Menschen zu erreichen, die selbst emotionale Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben. Bei ihnen ist das Risiko erhöht, entsprechende Muster weiterzugeben.“
Auch Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, betont: „Gewalt hinterlässt Spuren – oft ein Leben lang. Körperliche und emotionale Gewalt gefährden nicht nur die Gesundheit von Kindern, sondern auch ihre Bildungschancen und ihre seelische Gesundheit im Erwachsenenalter. Gerade in einer sich verändernden Welt muss der Schutz vor Gewalt in der Kindheit endlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ernst genommen und deutlich verstärkt werden.“
Weitere Ergebnisse der Befragung
Nur rund die Hälfte der Befragten gibt an, keine emotionalen Strafen in ihrer eigenen Erziehung erlebt zu haben.
Wer in der Kindheit selbst emotionale Strafen erlebt hat, stimmt solchen Erziehungsmethoden deutlich häufiger zu. Rund die Hälfte der Befragten mit eigener Erfahrung stimmen emotionalen Strafen zu (49,3 Prozent), gegenüber nur zwei Prozent ohne entsprechende Erfahrungen.
Während zwei Drittel der Befragten mit eigener Erfahrung emotionaler Strafen angibt, diese Erziehungsmethoden auch bei den eigenen Kindern angewendet zu haben, liegt dieser Anteil bei denen ohne solche Erfahrungen lediglich bei 5,4 Prozent.
Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz von Kindern vor Gewalt
Folgende Ansätze sind dringend notwendig, um Kinder nachhaltig vor Gewalt zu schützen:
Kinderrechte stärken: Die Geschichte der gewaltfreien Erziehung in Deutschland zeigt, wie gesetzliche Maßnahmen zu nachhaltiger positiver gesellschaftlicher Veränderung führen. Eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz würde die Rechtsposition von Kindern zusätzlich stärken und so die Rahmenbedingungen für einen wirksamen Kinderschutz und die Teilhabe von Kindern in allen Lebensbereichen verbessern.
Den Begriff der gewaltfreien Erziehung erweitern: Die gesetzliche Norm zum Recht auf gewaltfreie Erziehung berücksichtigt bislang nicht die Misshandlungsform der Vernachlässigung. Während körperliche und zunehmend auch emotionale Gewalt gesellschaftlich weitgehend abgelehnt werden, fehlt die gleiche Sensibilisierung für die Folgen unterlassener Fürsorge. Der Begriff der gewaltfreien Erziehung sollte daher im Bürgerlichen Gesetzbuch auf Vernachlässigung ausgeweitet und auch diese Form der Gewalt gesetzlich geächtet werden.
Gezielte Prävention fördern: Um Kinder wirksam zu schützen, sollte das Bewusstsein für die Folgen körperlicher und psychischer Gewalt gestärkt und Prävention an aktuelle Realitäten angepasst werden. Neben Aufklärungskampagnen braucht es gezielte Strategien, die auch die digitalen Lebenswelten junger Menschen und das Setting Familie berücksichtigen. Neben allgemeiner Aufklärung und Sensibilisierung sollten zudem gezielte Unterstützungsangebote für Risikogruppen sowie frühzeitige Hilfen bei erkennbaren Belastungen ermöglicht werden, um Gewalt in der Erziehung vorzubeugen (Verankerung selektiver und indizierter Prävention zusätzlich zur Primärprävention in § 20 SGB V).
Datenlage zu Gewalt in der Erziehung verbessern: Die Datenlage zur Gewalt in der Erziehung in Deutschland ist weiterhin lückenhaft. Systematische Datenerhebungen sind entscheidend, um Ausmaß und Risiken zu erkennen, wirksam gegenzusteuern und politischen wie gesellschaftlichen Handlungsdruck zum besseren Schutz von Kindern aufzubauen – gerade in Zeiten tiefgreifender digitaler Veränderungen.
Service für die Redaktionen
Mit Unterstützung von UNICEF Deutschland und einer philanthropischen Stiftung hat ein Forschungsteam der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm zwischen Oktober 2024 und Februar 2025 2.530 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Die aktuelle Studie baut auf bestehenden Arbeiten zur Akzeptanz von Körperstrafen auf und untersucht, wie sich Einstellungen seit Inkrafttreten des Rechts auf eine gewaltfreie Erziehung im Jahr 2000 verändert haben.
Im April 2025 wurden die Ergebnisse der Befragung zu Einstellungen gegenüber körperlichen Strafen in der Erziehung und deren wahrgenommener Angemessenheit veröffentlicht (s. hier). Demnach hat die Akzeptanz körperlicher Bestrafung einen historischen Tiefpunkt erreicht. Der aktuelle Ergebnisbericht umfasst sowohl die Einstellungen zu körperlicher Gewalt als auch zu emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern.
Der ausführliche Bericht zur aktuellen Befragung steht hier zur Verfügung.
Seit 2000 macht UNICEF Deutschland mit der Kampagne #NiemalsGewalt auf Gewalt gegen Kinder aufmerksam. Weitere Informationen stehen hier zur Verfügung.
Pressekontakte
Emily Sitarski, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, 0173 3490293, emily.sitarski@uniklinik-ulm.de
Christine Kahmann, UNICEF Deutschland, 030 275807919 / 0159 04139723, presse@unicef.de